
Facts
Alle Facts
Die Abfallstatistik der Stadt Thun zeigt einen allgemeinen Rückgang der Abfallmengen und einen Wandel im Entsorgungsverhalten der Bevölkerung. Ein paar spannende Zahlen:
Weniger Hauskehricht: Die Menge an Hauskehricht ist von 10'377 Kilogramm im Jahr 2017 auf 6'643 Kilogramm im Jahr 2023 gesunken.
Rückgang bei Separatsammlungen: Auch die gesammelten Wertstoffe wie Papier, Glas, Metalle, Kunststoffe und Batterien haben abgenommen – von 13'845 Kilogramm im Jahr 2017 auf 11'510 Kilogramm im Jahr 2023.
Pro-Kopf-Betrachtung im Jahr 2023:
Jede Person in Thun produzierte durchschnittlich 216 Kilogramm Hauskehricht
Pro Person wurden zudem 259 Kilogramm recyclierbarer Abfall an Sammelstellen gesammelt.
Quelle: Abfallstatistik Stadt Thun 2023, Tiefbauamt
Kunststoffabfälle machen einen erheblichen Teil des Hauskehrichts aus und werden meist verbrannt. Da die Verbrennungskapazitäten in der Schweiz langfristig gleich bleiben, die Bevölkerung aber wächst, wird die Reduktion von Abfällen immer wichtiger. Zwei zentrale Strategien helfen dabei:
Abfallvermeidung
Mehrwegprodukte, verpackungsfreies Einkaufen und die Wiederverwendung statt Wegwerfen sind entscheidende Schritte hin zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft. Mehr dazu unter diesem Fact: Kreislaufwirtschaft: Ressourcen schonen, Abfall reduzieren, Wert erhalten
Recycling
Haushaltskunststoffe lassen sich über Sammelsysteme wiederverwerten. Dabei unterscheidet man zwei Verfahren:
Mechanisches Recycling: Dabei werden Kunststoffe eingeschmolzen und wiederverwendet. Zum Beispiel Getränkeflaschen aus PET. Dieses Verfahren ist kostengünstig und einfach, jedoch ist die Qualität des recycelten Materials stärker abhängig von der Qualität des Originalkunststoffs.
Chemisches Recycling: Dabei wird Kunststoff in seine chemischen Grundstoffe zerlegt, so dass hochwertiges Recyclingmaterial entsteht. Dieses Verfahren ist jedoch energieintensiver und wird in der Schweiz derzeit nicht industriell angewendet.
Ein grosses Hindernis beim Kunststoffrecycling sind komplexe Verpackungsmaterialien mit mehreren Schichten, die schwer zu trennen sind. Um das zu verbessern, setzen Forschungsprojekte auf Ökodesign, das Verpackungen von Anfang an recycelbarer macht.
Derzeit gibt es in der Schweiz keine Sortieranlage für Haushaltsplastik – das gesammelte Material wird ins Ausland transportiert. Damit ein inländisches System wirtschaftlich tragfähig wird, müssen die Sammelmengen steigen und das Verpackungsdesign optimiert werden.
Recycling-Erfolge der Schweiz
Während das Kunststoffrecycling noch Herausforderungen birgt, erzielt die Schweiz in anderen Bereichen beeindruckende Recyclingquoten:
Altpapier: 81 %
Altglas: 95 %
PET-Getränkeflaschen: über 82 %
Aluminiumverpackungen: 91 %
Mit einer gesamten Recyclingquote von 52 % zählt die Schweiz zu den führenden Ländern Europas. Eine weitere Steigerung des Recyclings und der Abfallvermeidung ist essenziell, um die Umweltbelastung nachhaltig zu reduzieren.
Quellen:
Die Kreislaufwirtschaft, kurz KLW, ist ein Begriff, dem wir immer häufiger begegnen. Was aber heisst Kreislaufwirtschaft eigentlich?
Die Kreislaufwirtschaft unterscheidet sich grundlegend von der weit verbreiteten linearen Produktion, bei der Rohstoffe abgebaut, Produkte hergestellt, konsumiert und schliesslich entsorgt werden. Das System der linearen Produktion führt zu Ressourcenknappheit, Emissionen, hohen Abfallmengen und damit verbundenen Umweltbelastungen.
In der Kreislaufwirtschaft hingegen wird zirkulär produziert, das heisst: Produkte und Materialien bleiben so lange wie möglich im Umlauf. Sie werden geteilt, wiederverwendet, repariert und aufbereitet, bevor sie recycelt werden. Das spart wertvolle Rohstoffe, reduziert Abfall und schont die Umwelt – und oft auch das Portemonnaie.

Quelle: BAFU
Für Unternehmen und Organisationen entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten, etwa durch Reparaturservices oder Mietmodelle anstelle von Verkauf. Erst wenn ein Produkt nicht mehr nutzbar ist, wird es recycelt.
Allerdings gilt: Je länger ein Produkt genutzt wird, desto besser für die Umwelt, da auch Recycling Energie und Ressourcen verbraucht.
Unsere Tipps:
Die Avocado hat aufgrund ihres hohen Wasserverbrauchs und langer Transportwege einen schlechten Ruf. Doch wie schneidet sie im Vergleich zu Fleisch ab? Betrachten wir die benötigten Ressourcen, zeigt sich, dass tierische Produkte – insbesondere Rindfleisch – eine weitaus grössere Umweltbelastung darstellen.
Wasserverbrauch
Für die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden durchschnittlich etwa 15’000 Liter Wasser benötigt. Im Vergleich dazu liegt der Wasserverbrauch für ein Kilogramm Avocados bei rund 2’000 Litern. Obwohl Avocados als «durstige» Frucht gelten, ist ihr Wasserverbrauch im Vergleich zu Fleisch deutlich geringer.
CO₂-Fussabdruck
Die Produktion, Verpackung und der Transport von einem Kilogramm Avocados verursachen durchschnittlich 2.5 Kilogramm CO₂-Äquivalente. Im Vergleich dazu verursacht die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch deutlich höhere Emissionen von 60 Kilogramm CO₂-Äquivalente.
Was kann ich beim Einkaufen beachten?
Um den ökologischen Fussabdruck zu minimieren, sollten Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Avocados auf Bio-Qualität und möglichst regionale Herkunft achten. Zudem ist es ratsam, den Verzehr von tierischen Produkten zu reduzieren und durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. Generell ist der Grundsatz «Bioproduktion: regional / saisonal» die wichtigste zu befolgende Regel, da für die Kaufentscheidung nicht nur die Umweltfaktoren, sondern auch die Arbeitsbedingungen für deren Produktion eine wichtige Rolle spielen.
Unsere Tipps:
Eine bewusste Auswahl der Lebensmittel trägt massgeblich zum Umwelt- und Arbeitnehmerschutz bei. Obwohl Avocados aufgrund ihres Wasserverbrauchs und langer Transportwege nicht unbedenklich sind, ist ihre Umweltbelastung im Vergleich zu Fleisch, insbesondere Rindfleisch, geringer. Ein massvoller Konsum von Avocados und eine Reduzierung des Fleischkonsums können somit einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Quellen:
Das Klima zeigt, was über viele Jahre hinweg typisch ist: Wie warm oder feucht es in einer Region meistens ist und wie viel Niederschlag dort fällt. Die Grundlage sind langjährige Messungen, die zu Mittelwerten zusammengefasst werden.
Das Wetter beschreibt, wie die Atmosphäre gerade jetzt ist – das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Es ist eine einzelne Momentaufnahme und nur ein kleiner Mosaikstein im Gesamtbild des Klimas.
Eine Veränderung vom Klima zeigt sich über mehrere Jahre hinweg, basierend auf statistischen Daten.
Auch Schnee und Kältewellen im Winter bedeuten nicht, dass sich das Klima nicht langfristig erwärmt!
Mein letzter Schneemann
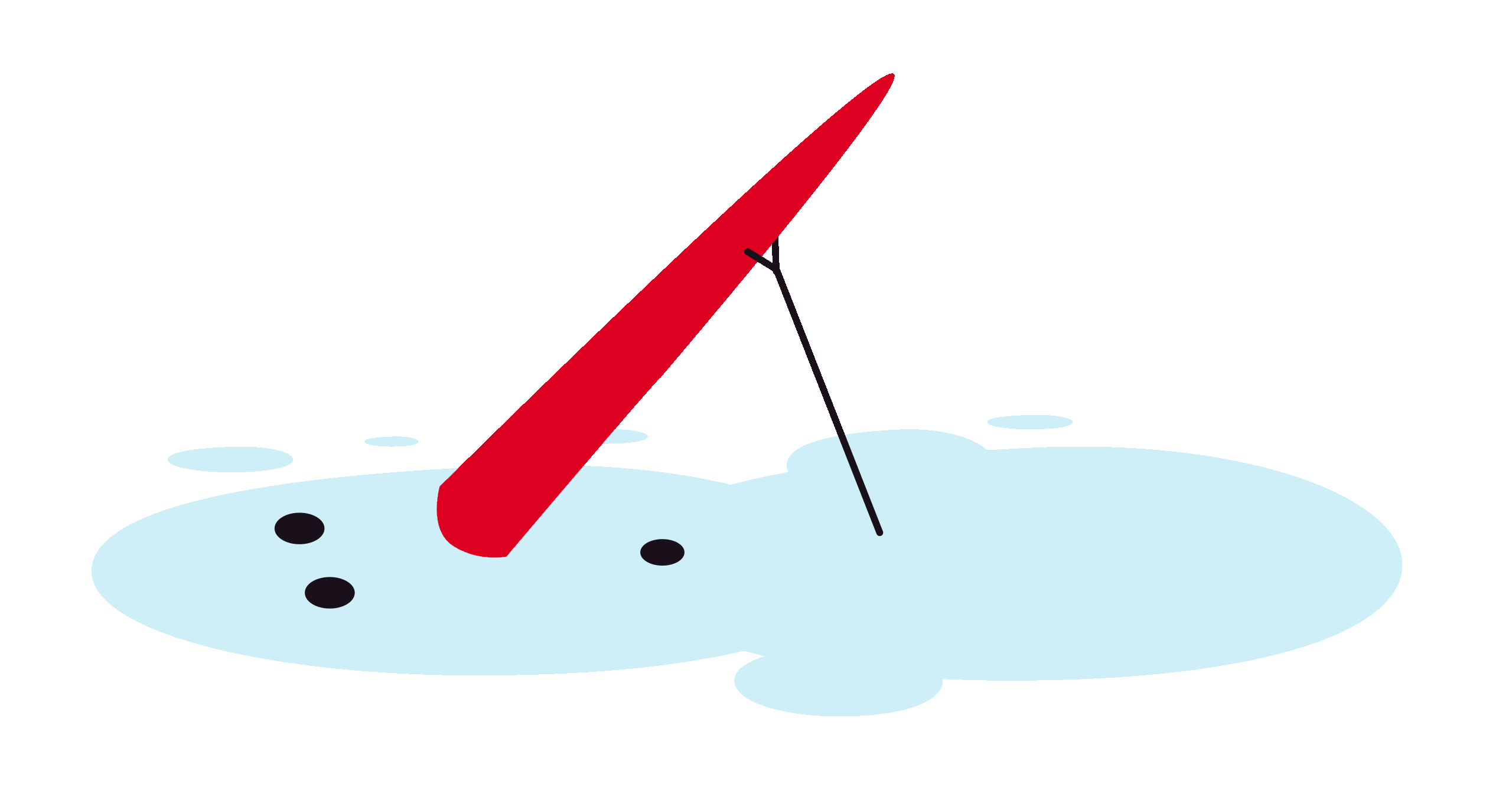
In der Schweiz liegt die Nullgradgrenze heute rund 400 Meter höher als vor 60 Jahren. Dadurch gibt es seit 1970 in Lagen unter 800 m ü. M. – also etwa in der Stadt Thun – nur noch halb so viele Schneetage wie zuvor.
Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts könnte die Nullgradgrenze um weitere 400 bis 650 Meter steigen.
Quellen:
Im Jahr 2019 wurden auf dem Gebiet der Stadt Thun rund 205’000 Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. Diese setzten sich zusammen aus:
CO2-EMMISSIONEN IN DER STADT THUN 2019

Wo kann ICH DAS MITVERFOLGEN?
Im Aktionsplan der Klimastrategie Thun ist die Massnahme «M 12 Monitoring und Controlling der Treibhausgasemissionen und Massnahmenumsetzung» zu finden. In der Stadt Thun wird ein Monitoring erarbeitet, in dem alle relevanten Indikatoren zu Thuner Treibhausgasemissionen dargestellt werden.
Die erste Bilanz für das Jahr 2022 wird voraussichtlich per Ende 2024 verfügbar sein. Vorgängig können Thuner Emissionen auf der Energiedatenplattform des Kantons Bern eingesehen werden.
Wo kANN ICH EINEN UNTERSCHIED machen?
Thunerinnen und Thuner können beim Wohnen und bei der Mobilität den grössten Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen auf Thuner Boden leisten.
Um das Ziel Netto-Null beim Wohnen erreichen zu können, muss sowohl die Effizienz der Gebäude gesteigert wie auch die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien gedeckt werden.
Im Bereich Mobilität braucht es, neben einer Verkürzung von Verkehrswegen durch eine klimafreundliche Stadtplanung, eine Verlagerung hin zu möglichst umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und Antriebssystemen. Im Personenverkehr steht die Verlagerung des motorisierten Individualverkehres auf ÖV, Fuss- und Veloverkehr im Fokus. Der verbleibende motorisierte Verkehr, der sich nicht verlagern lässt, muss verbessert werden, um die Emissionen zu reduzieren. Z.B. mit kleineren, leichteren, saubereren und leiseren Fahrzeugen. Durch eine höhere Belegung, z.B. mit Car Pooling oder Car Sharing, kann die Anzahl Fahrzeuge reduziert werden.
Kurz gesagt: Die Stadt Thun will bis 2050 klimaneutral sein.
Bei Netto-Null geht es um das Gleichgewicht zwischen den produzierten Treibhausgasen und der Menge, die wieder aus der Atmosphäre entfernt wird.
Die Stadt Thun will bis im Jahr 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und technische Senken aufnehmen können.
Ein Beispiel für eine biologische Senke ist die Umwandlung von Biomasse durch Hitzeeinwirkung unter Sauerstoffausschluss (sogenannte Pyrolyse) zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff in Pflanzenkohle. Damit kann Kohlenstoff langfristig aus der Atmosphäre entfernt werden. Auch das Pflanzen von Bäumen (Aufforstung) hilft, um Kohlenstoff zu speichern und den Gehalt in der Luft zu reduzieren.
Ein Beispiel für eine technische Senke ist das Absaugen von CO2 beim Kamin von Kehrichtverbrennungsanlagen. Damit wird aktiv versucht, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen.
Der Bericht «Grundlagen für die Klima- und Energiestrategie der Stadt Thun» zeigt, dass es nicht realistisch ist, das Ziel Netto-Null bereits im Jahr 2030 zu erreichen. Denn dafür wären strikte Verbote nötig und es müssten Heizungen, Anlagen und Fahrzeuge frühzeitig ersetzt werden.
Diese Kompetenzen liegen nicht bei der Stadt Thun, sondern beim Kanton.
Das Ziel Netto-Null 2050 ist hingegen erreichbar. Dieses Ziel entspricht der Klimastrategie die Bundes und ist mit den Zielsetzungen des Klimaabkommens von Paris vereinbar.
Das Internet ist eine Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), bei deren Verwendung Treibhausgasemissionen entstehen. Und zwar bei der Herstellung, dem Transport, dem Betrieb und auch bei der Entsorgung von Hardware. Die Verwendung von Laptops und Computern sowie der Betrieb und die Kühlung der Infrastruktur (z.B. der Serveranlagen und Leitungen) verbrauchen viel Strom. Dieser Strom stammt oft aus nicht umweltfreundlichen Quellen wie Kohle, Öl und Gas.
Laut Schätzungen ist die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik für 2-4 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und liegt damit im Bereich des weltweiten Flugverkehrs.
Diese global geltende Grundlage ist für die Schweiz nur begrenzt korrekt, da der Strom hierzulande nahezu vollständig klimafreundlich produziert wird. Viele gängige Handlungen im Internet, wie Google-Anfragen, das Streamen von YouTube-Videos oder das Durchführen von Microsoft-Updates laufen über Server, die in der Schweiz stehen. Da die Schweiz diesen sauberen Strom aber auch exportieren und damit Kohlestrom im Ausland ersetzen könnte, macht Energiesparen im Bereich ICT auch hier Sinn.
Es macht Sinn, weniger Online-Dienste zu nutzen, um das Klima zu schützen. Aber es gibt auch Tricks, um den Stromverbrauch zu verringern, ohne den Konsum reduzieren zu müssen. Denn jede Darstellung von Farben, Bildern und Videos verursacht einen höheren Stromverbrauch, sowohl bei den Servern wie auch beim Endgerät.
Hier kannst du ansetzen: Wenn du Musik hörst, verbraucht es weniger Strom, wenn du nur den Ton streamst und keine Bilder oder Videos dazu ansiehst. Viele Websites und Apps haben einen «Dark-Mode». Schaltest du diesen ein, hilft das, weniger Daten zu übertragen. Das senkt den Stromverbrauch. Zum Beispiel Google, YouTube und diese Landingpage hier, bieten diesen Dark-Mode an. Weiterhin gilt es zu bedenken, dass eine Chat-GPT-Anfrage, je nach Berechnung, zehn- bis zwanzigmal mehr Strom als eine einfache Google-Abfrage benötigt.
Beim Internet handelt es sich um eine Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Wenn die Nutzung dieser Technologien mehr Treibhausgase einspart als sie selbst verursacht, können sie zugunsten des Klimaschutzes eingesetzt werden.
Beispielsweise kann ICT klimafreundliche Entwicklungen, wie die Reduzierung von Reisebewegungen oder die effiziente Steuerung von Heizungen in Gebäuden fördern.
Entscheidungen von Unternehmen und Politik beeinflussen, wie viel CO2 durch die Nutzung von ICT in Zukunft eingespart wird. Eine Studie der Universität Zürich sagt voraus, dass in der Schweiz bis 2030 durch ICT eine Emissionsreduktion von 3.98 Megatonnen CO2/Jahr erwartet wird, obwohl das tatsächliche Potenzial bei 11.32 Megatonnen CO2/Jahr liegt.
Der Pro-Kopf-Konsum von in der Schweiz verkauftem Fleisch betrug im Jahr 2022 50.76 Kilogramm. Das ist rund 3x mehr als von der schweizerischen Lebensmittelpyramide empfohlen. Durch die Fleischproduktion werden grosse Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Besonders problematisch ist der hohe Futterbedarf in der Viehzucht: Für eine Kilokalorie an Rindfleisch werden beispielsweise sieben Kilokalorien aus pflanzlichen Futtermitteln benötigt. Somit geht ein hoher Teil der Nahrungsenergie verloren.
Um diese Probleme zu entschärfen, ist ein massvoller und regionaler Fleischkonsum angesagt.
Wie in der Roadmap zur Klimastrategie Thun aufgezeigt, macht die Kehrichtverbrennung rund ein Drittel der in Thun anfallenden Treibhausgasemissionen aus. Dazu kommen graue Emissionen, die für die Produktion und den Transport von Gütern anfallen. So führt der Konsum von in die Schweiz importierten Gütern zu erheblichen Emissionen im Ausland.
Energieberatung: Zukunft sichern, Geld sparen.
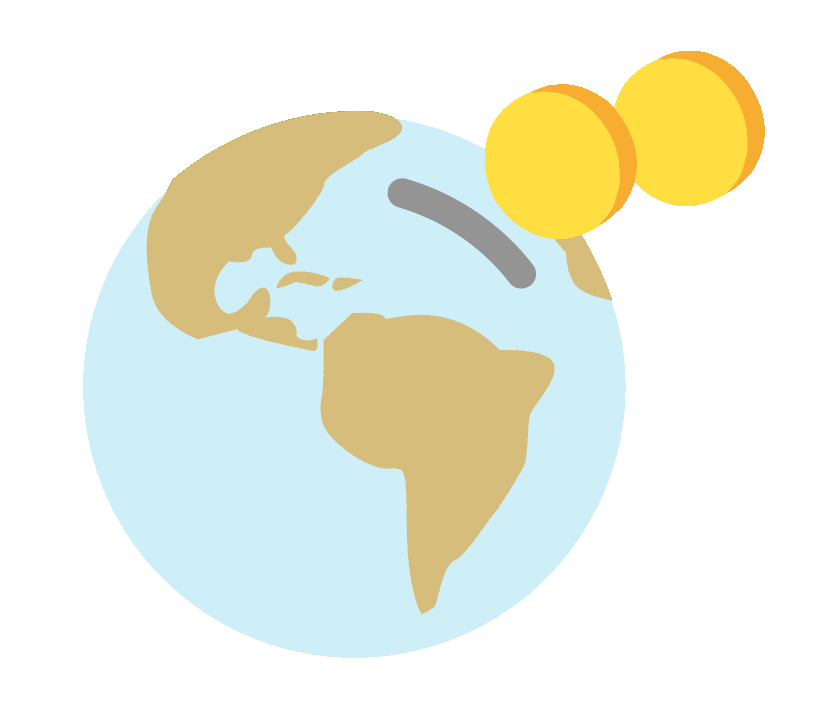
Die regionale Energieberatung unterstützt die Bevölkerung bei der Umsetzung von nachhaltigen Massnahmen im Energiebereich.
Möchten Sie sich in Energiefragen beraten lassen, zum Beispiel bezüglich Isolation, Heizsystemen oder Fördermassnahmen?
Die Fachstelle Umwelt Energie Mobilität empfiehlt eine neutrale Beratung bei der Regionalen Energieberatung Thun Oberland-West.
Telefonische Auskünfte, Onlinebesprechungen und Beratungsgespräche im Büro der regionalen Energieberatung sind bis zur Dauer einer Stunde kostenlos:
Termine Beratung: Onlinebuchungstool
Anschrift:
Regionale Energieberatung
Thun Oberland-West
Industriestrasse 6
Postfach 733
3607 Thun
E-Mail:


